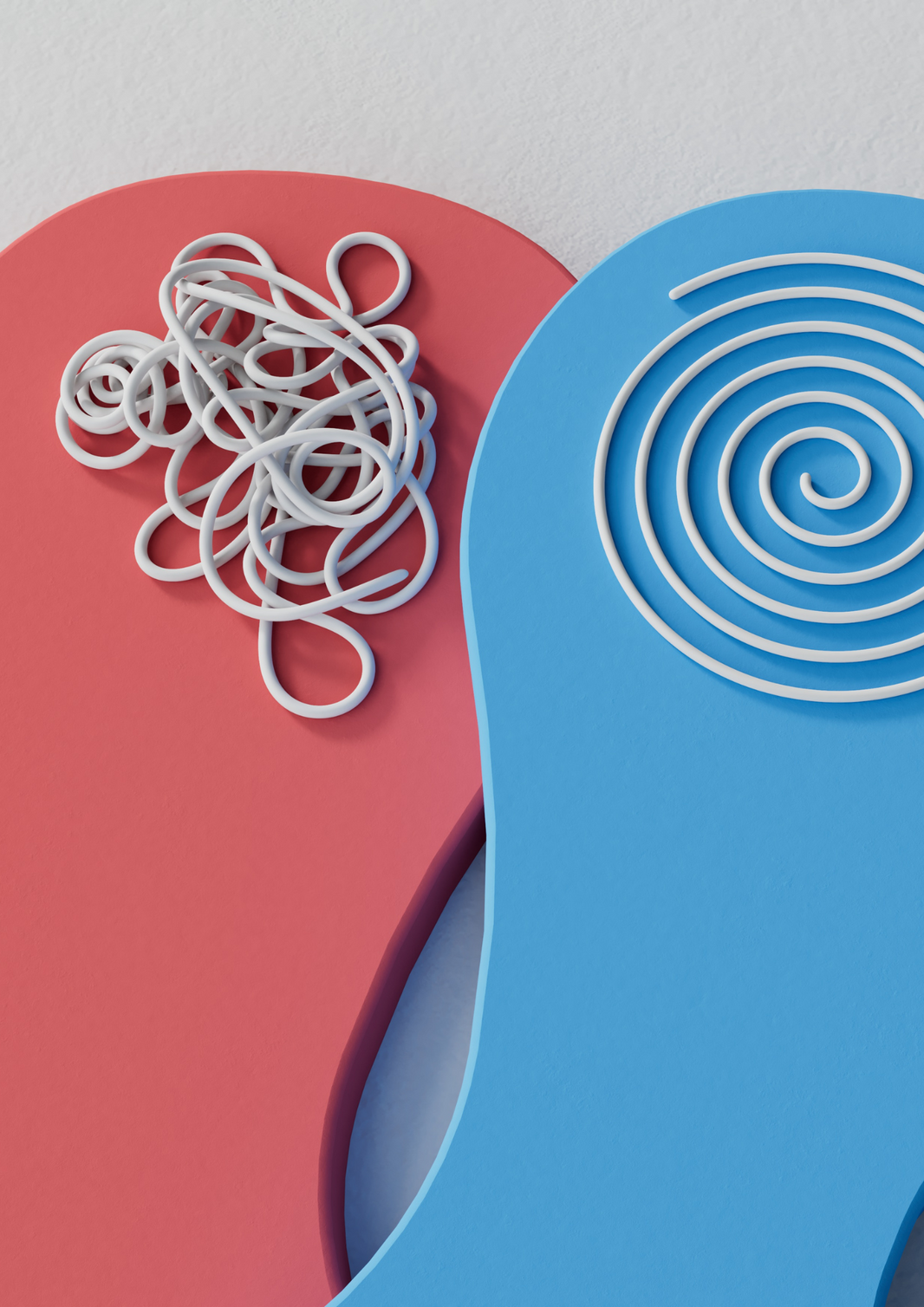
Klausurenlehre
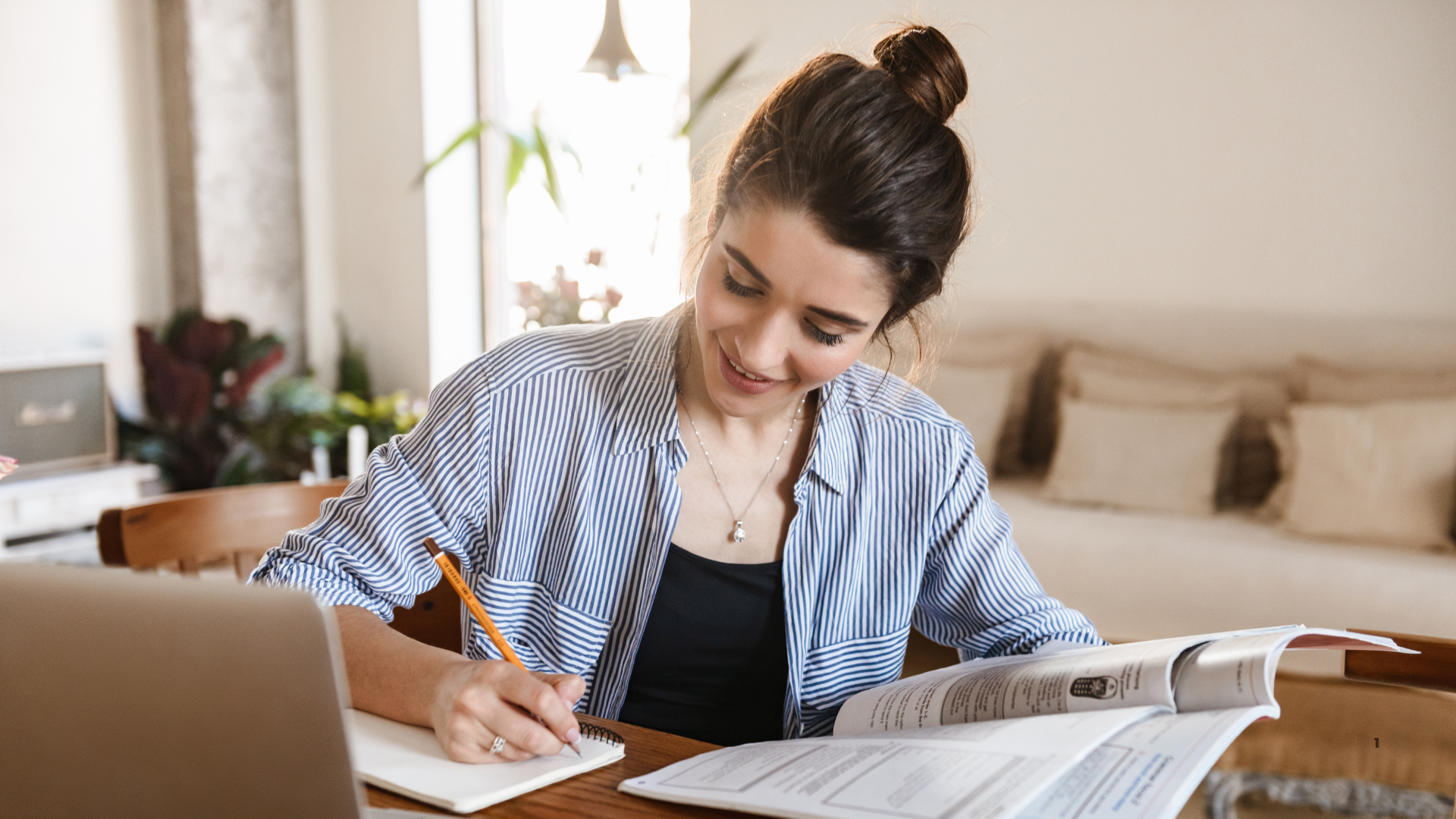
Viele Jurastudierende investieren enorme Zeit und Energie in die Klausurvorbereitung – besonders in der Phase der Examensvorbereitung. Doch trotz intensiven Lernens bleiben die erhofften Noten häufig aus. Das liegt nicht unbedingt an mangelndem Fachwissen, sondern vielmehr an Defiziten in der Klausurtechnik.
Eine wesentliche Ursache für nicht zufriedenstellende Ergebnisse ist außerdem das Fehlen einer systematischen Vorbereitung. Häufig wird nicht von Beginn des Studiums an strukturiert gelernt oder der Stoff wird zwar verstanden, aber nicht effektiv zusammengefasst und wiederholt. Darüber hinaus werden zu wenige Klausuren unter realistischen Prüfungsbedingungen geschrieben, was zu Unsicherheiten in der Klausursituation führt. Zeitmanagement-Probleme sind eine weitere häufige Fehlerquelle, da es ohne eine durchdachte Zeiteinteilung schwer ist, alle relevanten Punkte in der Klausur auszuführen.
Auf dieser Seite befassen wir uns mit den Standartproblemen der Klausurtechnik. Falls folgende 3 Punkte auf dich zutreffen, dann kann dir dieser Beitrag weiterhelfen:
Lösungsmöglichkeit: Arbeite an deiner Arbeits- und Klausurtechnik.
Schwerpunkt von diesem Beitrag ist es, durch die Vermeidung von Standardfehlern Schritt für Schritt zu besseren Noten zu gelangen.
Bemerkung zu Klausuranalyse: Eine individuelle und auf datenbasierte Analyse zur Verbesserung deiner Klausuren können wir dir nur anbieten, wenn du entweder einen interaktiven Lernplan erworben hast.
Dieser Beitrag richtet sich sowohl an Studierende, die sich noch am Anfang ihres Jura-Studiums befinden, als auch an Examenskandidaten, die ihre Klausurtechnik optimieren möchten.
Während es für Erstsemester besonders wichtig ist, von Beginn an eine saubere juristische Arbeitsweise zu entwickeln, profitieren fortgeschrittene Studierende davon, ihre Herangehensweise zu hinterfragen und gezielt an ihren Schwachstellen zu arbeiten.
Studierende in der Examensvorbereitung sollten diesen Beitrag als eine Möglichkeit sehen, typische Standardfehler zu erkennen und ihre Technik gezielt zu verbessern. Dabei ist es sinnvoll, den gesamten Beitrag zu lesen und einzelne Aspekte, die bereits gut beherrscht werden, gegebenenfalls nur zu überfliegen. Durch eine kritische Selbstreflexion lässt sich erkennen, wo noch Lücken bestehen, die in den nächsten Klausuren gezielt geschlossen werden können.
Eine bloße Lektüre wird dich nicht weiterbringen, wenn du das Gelernte nicht aktiv anwendest. Es ist daher empfehlenswert, sich beim Lesen Notizen zu machen und das eigene Wissen regelmäßig zu reflektieren.
Es ist wichtig, die erlernten Techniken nicht nur theoretisch zu verstehen, sondern sie auch konsequent in der Praxis anzuwenden. Dabei solltest du jedoch nicht versuchen, deine gesamte Klausurtechnik auf einmal umzustellen, da dies schnell überfordernd wirken kann. Stattdessen empfiehlt es sich, maximal drei neue Techniken pro Klausur bewusst zu integrieren und so schrittweise eine nachhaltige Verbesserung zu erzielen.
Ein besonders hilfreiches Werkzeug sind standardisierte Textbausteine, die in jeder Klausur wiederverwendet werden können. Diese sollten so weit verinnerlicht sein, dass sie im Ernstfall ohne großen Zeitaufwand abrufbar sind. Dadurch kannst du dich auf die inhaltlichen Schwerpunkte konzentrieren und verlierst keine wertvolle Zeit mit der Formulierung von Standardsätzen.
Deine wertvolle Lebenszeit, die du zum Schreiben einer (Probe-)Klausur investiert hast sollte entsprechend gewürdigt werden. Dafür haben wir die interaktive Lernpläne konzipiert, damit du deine Klausuren an einem Ort erfassen kannst. Damit kannst du deinen Lernerfolg schrittweise in jedem Gebiet verfolgen und mit deinen Fragen dich an einen unserer Klausurexperten wenden. Sie sind für die Auswertung dieser Grafiken geschult und können dir konkrete Tipps und Tricks für deine nächsten Klausuren an die Hand geben.
Jurastudierende stehen in der Klausur regelmäßig vor der Herausforderung, komplexe Rechtsfragen zu lösen. Doch welche Erwartungen hat der Korrektor an deine Klausur? Es ist nicht erforderlich, alle möglichen Fallkonstellationen auswendig zu lernen. Vielmehr kommt es darauf an, dass du ein überzeugendes Argumentationsgerüst aufbaust und den Gutachtenstil präzise anwendest. Ein Korrektor möchte in der Klausur bis zum ersten Staatsexamen sehen, dass ein Prüfling in einem Fall sinnvoll argumentieren kann. Die Prüfungsordnungen der Bundesländer bestätigen diesen Erwartungshorizont.
Mit der Prüfung des 1. juristischen Staatsexamen möchte das Prüfungsamt prüfen, ob der Sachbearbeiter würdig ist das Referendariat anzutreten. Dies umfasst folgende drei Punkte:
Die Prüfungsschwerpunkte liegt damit an der strukturierten Denk- und Herangehensweise. Um das Prüfungsamt von deiner Würde zu überzeugen, solltest du in deiner Klausur die Rechtsfragen mit einer strukturierten Rechtslösung anhand des deutschen Rechtssystems anbieten.
Ein Rechtsproblem entsteht in der Regel durch widerstreitende Interessen. Zwei Parteien erheben widersprüchliche Ansprüche und die rechtliche Klärung ist erforderlich. Das Ziel des Rechtssystems ist es, solche Konflikte fair und objektiv zu lösen. Deine Aufgabe in der Klausur besteht darin, diese Probleme nicht nur zu erkennen, sondern sie auch richtig in deine Argumentation einzubetten.
Um ein Rechtsproblem im Gutachten richtig einzubetten ist es sinnvoll kleinschnittig von einem Prüfungspunkt zum nächsten zu gehen. Im Gutachten öffnen sich Fragen die man kurz oder schnell abhacken kann. Dabei geht man vom allgemeinen zum konkreten Rechtsfrage. Jeder Prüfungspunkt muss argumentativ gut begründet werden.
Eine gute Rechtsklausur zeichnet sich durch Struktur, Argumente und Vermeidung von schweren Fehlern aus. Diese drei Faktoren unterscheiden schlussendlich eine gute von einer weniger guten Klausurbearbeitung. Auch wenn in beiden Fällen alle Themen in der Musterlösung angesprochen wurden, ist es wichtig die strukturelle Gesetzesanwendung und argumentative Begründung schriftlich nachzuweisen.
Die Struktur einer guten Klausur zeichnet sich dadurch aus, ob
Eine gute Argumentation in einer guten Klausur zeichnet sich dadurch aus, ob
Ein Fehler gilt als besonders schwerwiegend, wenn gegen grundlegende Prinzipien des Rechts verstoßen wird. Dazu zählen etwa
In einer juristischen Gutachtenklausur werden folgende Kriterien abverlangt:
Diese Fähigkeiten lassen sich gebündelt in einem Rechtsgutachten im Gutachtenstil prüfen:
Damit du siehst, worin der Unterschied zwischen einer schlechten und einer guten Ausführung liegt haben wir zwei Beispiele für dich:
Da es in Jura nur darauf ankommt, eine nachvollziehbare und eine am Gesetz sich orientierte Lösung zu präsentieren, gibt es selten ein Richtig oder Falsch. Falsch kann eine Lösung nur sein, wenn es eindeutig gegen das Gesetz verstößt. Obwohl der Korrektor entscheidet, welche Meinung oder Lösung vertretbar ist, muss er sich an das Prüfungsrecht halten. Als Faustregel gilt dabei: Eine Meinung ist vertretbar, wenn diese Meinung in der Fachliteratur auch vertreten wird. So auch die Meinung vom Bundesverfassungsgericht zum Prüfungsrecht:
Der Korrektor muss also die durch das Rechtssystem begründeten Lösungssätze als richtig bewerten. Hat der Korrektor eine in der Fachliteratur genannten Meinung als falsch gewertet, so hat eine Nachkorrektor Aussicht auf Erfolg.
Ein Gesetzesverstoß liegt vor, wenn der Sachverhalt nicht komplett rechtlich gewürdigt wird, ein Gesetz nicht oder nicht richtig angewendet wird. Letzteres liegt vor, wenn man eine Norm nicht beachtet, die zum Prüfungsgegenstand gehört. Hierbei gliedert man die Klausur falsch und gelangt damit zu einem nicht mehr vertretbaren Ergebnis.
In den höheren Semester werden diese Fehler strenger bewertet als in den Anfangssemestern. Damit sollst du besser auf das Examen vorbereitet werden. Eine eindeutig falsche Lösung liegt aber insbesondere dann vor, wenn du an den Klausurfragen vorbei geschrieben wird.
Beispiele zu falschen Ergebnissen:
Um bessere Klausuren zu schreiben ist es sinnvoll zu wissen, wie Klausuren entstehen. Es gibt jedoch keine festgelegte Herangehensweise. In der Regel überlegt man sich ein Thema für die Klausur aus und sucht nach bekannten Urteilen oder Fällen. Anschließend wir dein Im Korrekturleitfaden für den Korrektor am Anfang auf den Schwerpunkt hingewiesen und damit die Erwartungshaltung vermittelt. Es wird dann erwartet, dass der Klausurbearbeiter den Schwerpunkt erkennt und entsprechend bewertet wird. Die Klausur hat dann diese Themen zum Gegenstand:
Steht das Thema einmal fest, überlegt sich der Klausurersteller welche Rechtsnormen und Einzelprobleme in die Klausur aufgenommen werden muss. Hierbei lassen sich Klausurensteller oft von veröffentlichte Urteile inspirieren. Sie fügen dann aus der Rechtssprechung einzelne Probleme in die Bearbeitung ein. Dabei notieren Sie sich Sachverhaltskonstellationen aus der Entscheidung und die im Urteil vertretenen Lösungsansätze. Dadurch ersparen sie sich die Mühe, sich eigene Fälle ausdenken zu müssen. Bei der Erstellung der Klausur bezieht man auch die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade der Probleme mit ein und kennzeichnet diese in der Lösungsskizze.
Im Leitfaden gibt der Klausurersteller auch an, welche Probleme besonders leistungsstarke Bearbeiter erkennen sollte und welche Grenze zum Bestehen der Klausur überschritten werden muss.
Nachdem der Ersteller ausreichende Rechtsprobleme ausgesucht und den Schwierigkeitsgrad sowie den Bewertungsmaßstab festgelegt hat, muss er die unterschiedlichen Probleme zu einem Sachverhalt zusammenfassen. Diese Prüfungsklausur wird i.d.R. von Testkandidaten geschrieben, um Inhalt und Quantität zu überprüfen.
Für dich als Klausurbearbeiter bedeutet das, dass (i.d.R.) die Klausur keine Fehler enthält und der Sachverhalt bewusst so formuliert wurde. Andererseits musst du herausfinden, welche Themen und Rechtsprobleme der Klausurensteller in der Klausur eingebracht hat.
In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit der Herangehensweise mit Klausursachverhalten. Wir beschäftigen uns also mit der Klausuranalyse: wie kann ich möglichst viele Informationen aus dem Sachverhalt sinnvoll verarbeiten und welche Hinweise hat der Klausurersteller für mich hinterlassen?
In der Klausur wird dir ein in einem Raum ein Tisch und ein Stuhl zur Verfügung gestellt, sowie es auch ausreichend für Licht und Wärme gewährleistet wird. Der Sachverhalt wird auf einem DIN A4 Blatt gedruckt und dir in verdeckter Weise auf dem Tisch gelegt. Sobald die Bearbeitungszeit beginnt, darfst du diese Klausur umdrehen und mit der Bearbeitung beginnen. Als Hilfsmittel sind die in der Prüfungsordnung erwähnten Gesetze un Stifte zulässig. Im Studium darfst du auch deine eigenen Klausurblätter mitnehmen. Weiterhin ist es an den meisten Universitäten auch erlaubt, während der Bearbeitungszeit zu essen. An diesem Vorgehen ändert sich bis zum 2. Staatsexamen nichts.
Die Klausur ist mit Sachverhalt und Bearbeitervermerk versehen. In diesem Teil erklären wir dir, wie du mit dem Sachverhalt umgehen sollst.
Als aller erstes liest du dir den Bearbeitervermerk dann die Fallfrage durch. Falls Normen oder Gesetze ausgeschlossen werden, markierst du dir dies mit einem Marker. Wird auf bestimmte Gesetze verwiesen, dann suche als erstes danach und lies dir diese erstmal durch.
Die Fallfrage gibt dir den ersten Obersatz vor und zeigt dir, worum es sich in der Klausur handelt. Die Fallfrage und der Bearbeitervermerk hilft dir die Klausur später richtig zu strukturieren und den Umfang einzugrenzen. Eine Folgefrage kann dir aber auch das Ergebnis der vorherigen Frage verraten. Erkennt man diese Hinweise nicht, verfehlt man wohlmöglich den Schwerpunkt der Klausur, auf die im Sachverhalt und im Bearbeitervermerk hingewiesen wurde.
Um den Einstieg in eine Klausur zu vereinfachen gehe bitte sicher, dass du die Fallfrage richtig verstanden hast. Es ist in Ordnung, wenn du dir hier mehr Zeit lässt. Sobald du die Frage verstanden hast, wandele die Frage in einen Aussagesatz um.
Nun schauen wir uns die Standardfallfragen der Klausuren an und erklären deren Bedeutung.
Im öffentlichen Recht wird man in den meisten Fällen nach den Erfolgsaussichten einer Klage oder eines Antrags gefragt.
In manchen Fällen kann aber auch nach einer Rechtsverletzung gefragt sein:
Hier ist nach einer Rechtsverletzung gefragt. Stellt man die Frage wieder in eine Aussage um, so lautet sie:
Es ist nur nach der Verletzung gefragt, nicht aber nach einem rechtlichen Vorgehen gegen eine solche Verletzung. Daher wäre ein Prüfung einer Klage oder Beschwerde nicht richtig.
Im Strafrecht ist die Fallfrage meist unproblematisch. Solltest du dennoch auf unverständliche Fragen stoßen, dann schreibe uns eine E-Mail an info@lawschoolgermany.de und wir nehmen auch diese hier auf.
Wie man den Sachverhalt richtig analysiert, ist eine individuelle Angelegenheit. Wir geben dir hier nun einige Tipps und Tricks an die Hand, damit dir mit Sicherheit nichts entgeht.
Schaue dir zunächst nur den Umfang an.
Nachdem du den Bearbeitervermerk und die Fallfrage gelesen hast, lese dir zunächst den Sachverhalt einmal ohne Markierung durch. Falls dir etwas einfällt, notiere es dir am Rand oder auf einem extra Zettel. Ob du nun langsam oder schnell lesen kannst, wichtig ist, dass du alle Informationen aufnehmen kannst und den Sachverhalt richtig verstanden hast. An dieser Stelle gibt es keine Möglichkeit Zeit zu sparen. Es ist eher wahrscheinlich, dass man etwas übersieht und durch Flüchtigkeitsfehler Punkte verschenkt.
Nun versuche jeden Abschnitt gedanklich zusammenzufassen. Überlege dir dabei, zwischen wem ein Problem liegt und warum es zu diesem Problem gekommen ist. Dieser Schritt dient dir dazu, sicher zu gehen, dass du jeden Abschnitt verstanden hast.
Bemerkung: Solltest du denken, dass dieser Punkt aufgrund Zeitmanagement weglassen kannst, dann solltest du wissen, dass es auch andere Methoden gibt dein Zeitmanagement zu verbessern. Weiterhin sparst du später auch wertvolle Zeit, wenn du nicht im Sachverhalt nach Informationen suchen musst.
Beim 2. mal Lesen gehst du detaillierter vor. Links vom Sachverhalt markierst du dir die Sätze. D.h. nach jedem oder jedem 2. Satz schreibst du links 1, 2, 3 ,4 ... und so weiter. Diese Markierungen dienen dir später in der Sachverhalts- und Lösungsskizze die Argumente schnell wieder zu finden.
Grundsätzlich ist jede Information im Sachverhalt im Gutachten zu verwerten. Hierbei ist jedoch Wichtiges von Unwichtigem und Problematisches von Unproblematischem zu trennen. Zu den wichtigen Informationen gehören insbesondere solche Informationen die auf dem Schwerpunkt der Klausur hinweisen. Das wären zum Beispiel Personen, Zeitangaben, Handlungen unbekannte Begriffe oder Personen.
Unterscheide zwischen Halteverbots- und Stoppschilder.
Der Klausurensteller möchte dich auf unwichtige Informationen (Halteverbot) mit Phrasen wie " - was zutrifft -" oder "wirksam" hinweisen. Als Faustregel gilt, je eindeutiger eine Situation im Sachverhalt angenommen wird, umso weniger musst du dazu schreiben. Solche Hinweise verdeutlichen dir, dass du hier keine langen Ausführungen machen sollst.
Beispiele im Zivilrecht:
Beispiele im Öffentlichem Recht
Beispiel 1: "Vorsätzlich", "Absichtlich" oder "Fahrlässig" deutet darauf hin, dass in der Prüfung keine Ausführung zur Rechtswidrigkeit oder Schuld gemacht werden soll. Geprüft kann aber, ob diese Begriffe zu den Tatbestandsvoraussetzungen gehören. Es kann sein, dass eine Strafnorm Vorsatz verlangt, in diesem Fall jedoch nur Fahrlässigkeit vorliegt.
Beispiel 2: "In rechtswidriger Weise" oder "Rechtswidrig" deutet darauf hin, dass in der Prüfung keine Ausführung zur Rechtswidrigkeit oder Schuld gemacht werden soll.
Beispiel 3: "In schuldhafter Weise" oder "Schuldhaft" deutet darauf hin, dass in der Prüfung keine Ausführung zur Rechtswidrigkeit oder Schuld gemacht werden soll.
Beispiel 4: „Eventuell erforderliche Strafanträge sind gestellt“ - Hier genügt der Hinweis am Ende der Strafnorm, dass "Ausweislich des Sachverhalts wurde der erforderliche Strafantrag gestellt. Dies ist ein Hinweis darauf zu achten, dass du am Ende der Strafnorm noch an die etwaigen erforderlichen Strafanträge denkst. Solltest du diese vergessen, dann bekommst du den Hinweis, dass im Bearbeitervermert explizit darauf aufmerksam gemacht wurde. Notiere dir neben jeder Strafnorm die jeweilige Norm, die auf die Strafanträge verweist und achte auch bei der Lösungsskizze darauf, dass diese am Ende erwähnt werden.
Allgemeine Beispiele
Beispiele im Zivilrecht
Beispiele im Öffentlichem Recht
Bemerkung: Solltest du nicht wissen, wann welche Theorie unter welchem Prüfungspunkt kommt, dann könnte das Lernen (zumindest in diesem Fach) eine Qual für dich darstellen. Damit du schnell verstehst, wie man solche "einfache" Fragen relative schnell ohne viel Nachdenken in der Klausur bearbeitet, empfehlen wir dir mit einem einen unserer Berater zu sprechen.
👉 Hier geht es zur Lernanalyse und Lernberatung. 🚀
Bespiele im Strafrecht
Allgemeine Hinweise
Eine der wichtigsten Fähigkeiten beim Bearbeiten einer juristischen Klausur ist es, Argumente aus dem Sachverhalt richtig zu erkennen, rechtlich einzuordnen und sinnvoll in die eigene Argumentation einzubinden. Klausuren enthalten oft gezielt platzierte Formulierungen, die Hinweise auf den Schwerpunkt der Prüfung geben. Diese Textbausteine sind nicht zufällig gewählt – sie lenken deine Aufmerksamkeit auf bestimmte juristische Probleme und können den Kern der Falllösung darstellen.
Sind im Sachverhalt Argumente enthalten, wird von dir erwartet, dass du diese rechtlich richtig im Gutachten einordnet und rechtlich bewertest. Diese weisen dich auf juristische Probleme hin und könnten wohlmöglich sogar den Schwerpunkt einer Klausur abbilden.
Es gibt Hinweise in den Klausuren, bei denen man denkt, man kennt schon die richtige Lösung. Aber pass bitte auf, es könnte sich um einen False Friend in der Klausur handeln.
Allgemein
Zirkelschlüssen: Ein Zirkelschluss (auch zirkuläres Argument oder circulus in probando genannt) ist ein logischer Fehlschluss, bei dem die Schlussfolgerung bereits in den Prämissen vorausgesetzt wird. Mit anderen Worten: Die Argumentation dreht sich im Kreis, weil das zu Beweisende bereits implizit oder explizit als Voraussetzung angenommen wird.
Beispiele im Zivilrecht:
Beispiele im Öffentlichem Recht
Beispiele im Strafrecht
Um die Informationen aus dem Sachverhalt für deine Gliederung und dann dein juristisches Gutachten zu filtern und zu sortieren, gibt es die Möglichkeit eine Sachverhaltsskizze anzufertigen.
Diese Methode beinhaltet alle Tipps und Tricks, die dich schrittweise zu besseren Klausuren verhelfen. Gehe dabei den Sachverhalt Satz für Satz durch und versuche die Informationen in dieses Muster einzutragen.
Schritt 1:
Nachdem du dein Sachverhalt einmal gelesen hast, teile den Sachverhalt in kleine Abschnitte und trage links die Abschnittsnummern ein. Diese Nummerierung hilft dir später zum Sachverhalt zu finden.
Schritt 2:
Schreibe oben die Fallfrage umgewandelt in einen Aussagesatz um.
• Im Zivilrecht: Wer will was von wem? - Das Woraus muss man dann nach Schritt 5 erarbeiten.
• Im Öffentliches Recht: Prüfung der Klage des A.
•Im Strafrecht: Strafbarkeit des A.
Schritt 3 :
Vom linken Rand ziehst du einen Strich von oben nach unten. Dies ist einZeitstrahl in chronologischer Weise von oben nach unten sortiert. Diese Methoden hat den Vorteil, dass du links vom Zeitstrahl die Zeitangabe und rechts davon die Handlungs- oder Geschehensangaben aufschreibst.
Schritt 4: Rechts oben vom Blatt, aber unter der Fallfrage, zeichnest du die rechtlichen Beziehungsverhältnisse auf. Versuche alle Verhältnisse in § zu übersetzen. Durch diese Rechtsbeziehungen kannst du den Fall besser durchdenken und dich in den Fall hineinarbeiten.
Beispiel aus Zivilrecht
Beispiel aus Öffentlichem Recht
Beispiel aus Strafrecht
Schritt 5: Nachdem du alle Zeitangaben und alle Verbindungen der Personen aufgezeichnet hast, kannst du dich fragen, wo genau liegt hier das Problem? Schreibe dir dann unten rechts auf, wo genau die Probleme liegen. Es können auch Folgeprobleme oder kleinere Probleme aufgeschrieben werden. In den meisten Fällen erscheinen dadurch nebenbei Rechtsfragen, die nicht unmittelbar in der Lösung auftauchen.
Wenn du mit der Skizze fertig bist, sollte deine Skizze alle Informationen aus dem Sachverhalt enthalten. Nun hast du einen Überblick über den Verlauf der Geschehnisse, Rechtsverhältnisse und Rechtsprobleme. Dies kann am Anfang etwas mühsam sein. Doch mit etwas Übung filterst du schon beim Lesen die Information und kannst diese Information leicht in das Muster eintragen. Nun kannst du übergehen zur Lösungsskizze.
Bei der Lösungsskizze suchst du zunächst nach Rechtsnormen im Gesetz, die eine Rechtsfolge enthalten, welche das Anspruchsziel der Personen wiedergibt.
Hast du also den Fall ordentlich skizziert, kannst du anfangen nach den einschlägigen Rechtsnormen zu suchen. Sortiere diese und versuche die passenden Normen bereits hier schon innerhalb der Anspruchsgrundlagen zu prüfen. Markiere gerne große Probleme mit einem p und kleine Probleme mit einem q. So erkennst du, ob du später mehr oder weniger dazu schreiben sollst.
Wann man in einer Klausur anfangen sollte zu schreiben ist sehr individuell. Es kommt dabei nicht nur darauf an, ob du schnell oder eher langsam denkst, sondern auch in welchem Fach du wie schnell arbeiten kannst? - Weiterhin kann es auch sein, dass du schnell schreiben kannst. Durch das Schreiben von Probeklausuren und die richtige Analyse deiner Ergebnisse bekommst du ein gutes Gefühl, wann du anfangen sollst zu schreiben.
👉 Hier geht es zur Klausuranalyse. 🚀
👉 Hier kannst du den Notfallplan herunterladen. 🚨
👉 Hier geht es zur Lernanalyse und Lernoptimierung. 🚀
In welcher Reihenfolge du deine Klausuren beantworten sollst, hängt ganz davon ab, on welchen Fach du dich gerade befindest und in welchem Ausmaß die Fragen gestellt sind. In den meisten Klausuren gibt es große und kleine Fragen. Du kleinen Fragen solltest du schnell abhaken können und nicht allzu viel Zeit verlieren.
Um einen allgemeinen Tipp geben zu können, beschränken wir uns auf die systematischen Prüfungsreihenfolge in allen Fächern:
Orientire dich erstmal am Gesetz und gehe dabei gedanklich alle Gesetzesmerkmale durch. Dies setzt natürlich voraus, dass du die wichtigsten Gesetze kennst und schon mal damit gearbeitet hast. In einer Klausur kannst du vereinzelt Gesetze erkunden und dir den Inhalt erarbeiten, in der Bearbeitungszeit ist es nicht jedoch nicht möglich jedes Gesetz neu kennenzulernen.
Es gibt aber auch prozessuale Aspekte, die Vorrang haben.
Es gibt Klausuren, die setzen ein bestimmtes Ergebnis der Vorfrage voraus.
In der juristischen Klausurbearbeitung wird üblicherweise der Gutachtenstil verwendet, der sich durch eine systematische Prüfung von Obersatz, Definition, Subsumtion und Ergebnis auszeichnet.
Die folgenden Abschnitte erläutern, wann der historische Klausuraufbau angebracht ist, wie er korrekt angewendet wird und welche strategischen Überlegungen bei der Nutzung von Hilfsgutachten zu beachten sind.
Neben dem klassischen Gutachtenstil gibt es eine alternative Herangehensweise an die juristische Fallbearbeitung, die als historischer Klausuraufbau oder auch “Märchenaufbau” bezeichnet wird. Dieser besondere Aufbau unterscheidet sich von der üblichen Methode dadurch, dass der Sachverhalt nicht nach rechtlichen Gesichtspunkten strukturiert wird, sondern streng chronologisch durchgearbeitet wird. Der Kern dieser Methode liegt darin, dass man die Rechtslage in den jeweiligen Zeitabschnitten des Falls prüft, um so die Entwicklung der Rechtspositionen nachzuverfolgen.
Diese Art des Aufbaus kommt allerdings nur in Ausnahmefällen zum Einsatz. Sie ist insbesondere dann anzuwenden, wenn eine bestimmte Rechtsposition im Laufe des Sachverhalts mehrfach wechselt und dieser Wechsel für die rechtliche Beurteilung entscheidend ist. Eine klassische Anwendung findet der historische Klausuraufbau beispielsweise bei der Prüfung von § 985 BGB (Herausgabeanspruch des Eigentümers gegen den Besitzer). Da hier die Eigentums- und Besitzverhältnisse entscheidend sind, müssen diese Schritt für Schritt für jede relevante Zeitspanne geprüft werden. Durch dieses Vorgehen kann sichergestellt werden, dass der letztendliche Eigentümer und Besitzer der Sache korrekt bestimmt wird.
Anwendungsfälle des historischen Klausuraufbaus
Diese besondere Methode eignet sich insbesondere für folgende Konstellationen:
Ein klassisches Beispiel für die Anwendung dieser Methode ist die Prüfung des Herausgabeanspruchs nach § 985 BGB. Dieser setzt voraus, dass der Kläger Eigentümer der Sache ist und der Beklagte Besitzer ohne Recht zum Besitz. Da Eigentum durch verschiedene Rechtsgeschäfte übertragen werden kann, muss in der Klausur geprüft werden, wer zu welchem Zeitpunkt Eigentümer und Besitzer war. So könnte der ursprüngliche Eigentümer E die Sache an B verkauft haben, dieser könnte sie an C weitergegeben haben, bevor der Kläger letztlich wieder Eigentümer wurde. Die Prüfung erfolgt daher schrittweise:
1. Ursprünglicher Eigentümer war E.
2. Es könnte sein, dass B die Sache von E erworben hat. Dies setzt voraus, dass ein Kaufvertrag zwischen E und B vorliegt und die Übergabe erfolgt ist.
3. Es könnte sein, dass C von B gemäß den Vorschriften des BGB Eigentümer wurde.
Durch dieses schrittweise Vorgehen kann am Ende eindeutig festgestellt werden, wer der aktuelle Eigentümer und damit anspruchsberechtigt nach § 985 BGB ist.
Ein weiteres Problem, das in Klausuren häufig auftritt, ist die Frage, wie mit Rechtsproblemen umzugehen ist, wenn eine Prüfung in eine Sackgasse führt. Viele Bearbeiter greifen dann auf das Konzept des Hilfsgutachtenszurück, um dennoch eine vollständige Prüfung zu gewährleisten.
Ein Hilfsgutachten ist eine alternative Lösungsmethode für den Fall, dass ein Sachverhalt nicht auf direktem Wege aufgelöst werden kann. Es wird verwendet, wenn eine bestimmte Voraussetzung fehlt, die Prüfung aber fortgesetzt werden soll, um andere Rechtsfragen zu klären.
Allerdings ist die Nutzung von Hilfsgutachten in der Fachliteratur höchst umstritten. Einige Kommentierungen argumentieren, dass die Arbeit mit Hilfsgutachten dazu führen kann, dass eine Prüfung künstlich in die Länge gezogen wird oder das eigentliche Problem nicht sauber gelöst wird. In manchen Klausuren findet sich sogar der Hinweis, dass „ggf. im Hilfsgutachten auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen einzugehen sei“.
Da das Wort „Hilfsgutachten“ bei manchen Korrektoren negativ konnotiert ist, sollte man es vermeiden, ohne Notwendigkeit auf diese Methode zurückzugreifen. Stattdessen empfiehlt es sich, den Weg des geringsten Widerstandszu gehen und den Sachverhalt aus einer alternativen Perspektive weiterzuprüfen.
Anstatt explizit ein Hilfsgutachten zu formulieren, kann man eine Alternativlösung verwenden, die weniger problematisch ist. Ein sinnvoller Satz könnte lauten: “Somit ergibt sich [Zwischenergebnis]. Vertritt man hingegen die Gegenauffassung, so könnte man auch zu dem Ergebnis kommen, dass …”
Durch diese Formulierung wird vermieden, das Hilfsgutachten direkt zu benennen, während die Prüfung dennoch vollständig bleibt.
Nun wenden wir uns dem formellen Teile einer Klausur zu. Wenn du einfache formelle Punkte beachtest, verdienst du dir Punkte und stehst im Verhältnis zu Anderen besser dar.
Als erstes solltest du sicher gehen, dass du die deutsche Juristensprache in Wort und Schrift beherrschst. Dazu gehören auch Rechtschreibung und Grammatik.
Solltest du Sprachprobleme feststellen oder sollte der Korrektor mehrfach deinen Sprachstil bemängeln, dann empfiehlt es sich ein paar Leitfäden oder Bücher zu diesem Thema zu lesen.
👉 Literaturempfehlung zur Verbesserung deiner Sprache.
Bei der Handschrift ist es etwas anders: diese muss lediglich lesbar sein. Sie führt aber nicht zu einer Besseren Note
Eine nichtlesbare Schrift jedoch verärgert der Korrektor und hinterlässt ihn schon beim ersten Eindruck einen negativen Eindruck. Achte bitte darauf, dass deine Schrift zumindest lesbar ist und du nicht schmierst.
Es gibt keine Standardzitierweise, die von dir erwartet wird. Du kannst also selbst entscheiden, wie du zitieren möchtest. Wichtig ist, dass du bei einem Stil bleibst und nicht wechselst.
Die einzelnen Bezeichnungen brauchst du nicht mit einem Kommer zu trennen. Ein Kommer setzt du nur ein, wenn du Normenketten hast.
Es gibt einige Abkürzungen die in einer Klausur anerkannt sind:
Bei genau zwei Möglichkeiten in einem Satz:
Bei mindestens zwei Möglichkeiten in einem Satz
Bei kleinen Buchstaben
Deine Klausur solltest du entweder alphanumerisch oder in dezimal Zahlen gliedern:
Ein gutes Gutachten kommt auch ohne Überschriften aus. Dein Gutachten sollte also auch ohne Überschriften verständlich aufgebaut sein. Wie das aussehen kann siehst du hier:
A. A könnte gegen B einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung in Höhe von 1000€ haben. Dazu müsste der Anspruch entstanden sein (I.), nicht erloschen (II.) und durchsetzbar (III.) sein.
I. Ein Anspruch setzt einen wirksamen Kaufvertrag gem. § 433 BGB voraus. Ein Vertrag entsteht dabei durch Angebot (§ 145 BGB) und Annahme (§ 147 BGB).
1. A könnte dem B ein Angebot unterbreitet haben, indem er die Ware auf den Kassenband legte.
a) Dies setzt ferner voraus, dass ....
A will für seine Frau ein schwarzes Klavier kaufen und bestellt auf der Website des B versehentlich ein weißes Klavier. Als er das weiße Klavier erklärt er gegenüber B wirksam die Anfechtung. Kann B von A den Kaufpreis verlangen?
Lösungsvorschlag:
Morgen steht deine Klausur an und du hast keine Zeit mehr für eine ausführliche Vorbereitung? Keine Panik! Mit der richtigen Herangehensweise kannst du auch kurzfristig das Beste aus deiner Klausur herausholen. Dieser Notfallplan hilft dir dabei, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren, deine Klausur systematisch anzugehen und unnötige Fehler zu vermeiden.
Bevor du mit dem Schreiben beginnst, musst du dir einen klaren Überblick über den Sachverhalt verschaffen. Eine unstrukturierte Bearbeitung führt oft dazu, dass du an der Fallfrage vorbeischreibst oder wichtige Aspekte vergisst. Daher solltest du diese Schritte unbedingt beachten:
Zunächst solltest du die Fallfrage genau lesen. Sie gibt vor, was du in deiner Klausur eigentlich beantworten musst. Überlege dir, worauf es in der Frage ankommt: Geht es um die Prüfung der Strafbarkeit einer Person, um einen zivilrechtlichen Anspruch oder um die Rechtmäßigkeit einer staatlichen Maßnahme? Eine präzise Erfassung der Fallfrage sorgt dafür, dass du deinen Fokus von Anfang an richtig setzt.
Im nächsten Schritt liest du den Sachverhalt sorgfältig durch. Dabei kommt es nicht nur auf das reine Verstehen des Textes an, sondern auch auf das Erkennen von Schlüsselstellen. Achte besonders auf Zitate, den Konjunktiv, Zeitangaben und Argumente, die auf mögliche Streitpunkte hinweisen könnten. Oft lassen sich aus der Formulierung des Sachverhalts bereits wichtige Hinweise auf problematische Rechtsfragen ableiten.
Nachdem du den Sachverhalt erfasst hast, ist es sinnvoll, eine Skizze anzufertigen. Diese sollte eine erste Struktur für deine Lösung enthalten. Überlege, welche rechtlichen Probleme sich aus dem Sachverhalt ergeben und in welcher Reihenfolge du sie prüfen musst. Eine gute Gliederung erleichtert dir später das Schreiben und sorgt dafür, dass du den roten Faden nicht verlierst.
Im Anschluss suchst du gezielt nach den passenden Rechtsnormen, die für die Beantwortung der Fallfrage entscheidend sind. Dabei solltest du nicht einfach irgendwelche Normen heranziehen, sondern gezielt prüfen, ob die jeweilige Vorschrift tatsächlich eine Lösung für das aufgeworfene Problem bietet. Wichtig ist hier insbesondere die Frage nach der Rechtsfolge: Welche Norm führt zu welchem Ergebnis?
Sobald du die relevanten Normen bestimmt hast, solltest du eine Gliederung erstellen. Diese gibt dir die notwendige Struktur für dein Gutachten vor. Achte darauf, dass deine Argumentation logisch aufgebaut ist und sich an der typischen Prüfungsreihenfolge orientiert. Eine gut durchdachte Gliederung verhindert, dass du dich während der Bearbeitung verzettelst oder wichtige Aspekte vergisst.
Nachdem du deine Analyse abgeschlossen hast, geht es an die eigentliche schriftliche Bearbeitung. Hierbei kommt es darauf an, deine Gedanken klar und nachvollziehbar darzustellen, sodass der Korrektor deiner Argumentation problemlos folgen kann.
Beginne mit einer sorgfältigen Ausformulierung. Vermeide es, einfach deine Skizze abzuschreiben – stattdessen solltest du deine Argumente juristisch präzise und sprachlich sauber ausarbeiten. Achte darauf, dass du nicht nur deine Schlussfolgerungen darstellst, sondern auch den Gedankengang, der dich zu diesen Ergebnissen führt.
Nutze Gliederungsebenen, um deine Lösung übersichtlich zu gestalten. Eine klare Struktur hilft nicht nur dir beim Schreiben, sondern auch dem Korrektor beim Nachvollziehen deiner Argumentation. Häufig unterläuft Studierenden der Fehler, sich in einem unstrukturierten Fließtext zu verlieren, was es für den Leser erschwert, die wesentlichen Punkte zu erkennen.
Achte auf eine präzise Formulierung der Obersätze. Jeder Obersatz sollte eine konkrete Rechtsfrage aufwerfen, die du anschließend im Gutachten beantwortest. Statt etwa zu schreiben „Es könnte ein Anspruch aus § 433 BGB bestehen“, solltest du präziser formulieren: „K könnte gegen V einen Anspruch auf Übereignung des Fahrzeugs aus § 433 Abs. 1 BGB haben.“ Dadurch wird sofort klar, worauf deine Prüfung abzielt.
Zum Abschluss deiner Klausur solltest du ein Gesamtergebnis formulieren. Hier fasst du deine Erkenntnisse in einem prägnanten Schlusssatz zusammen. Achte darauf, dass das Ergebnis klar und eindeutig ist, damit es für den Korrektor auf den ersten Blick verständlich wird.
Mit diesem Notfallplan kannst du dich trotz Zeitdruck auf die essenziellen Punkte konzentrieren und sicherstellen, dass deine Klausur strukturiert und überzeugend aufgebaut ist. Eine klare Analyse, eine durchdachte Gliederung und eine präzise Ausformulierung sind die Schlüssel zu einer erfolgreichen Klausur. Auch wenn du in der Vorbereitung nicht alles abdecken konntest, hilft dir diese Methode, das Beste aus deiner Klausur herauszuholen.
Es ist noch nichts in Ihrem Warenkorb